Piwi-Sorten – Der neue Weingeschmack
Auf den Bio-Boom folgt die Öko-Welle. Bei uns ist ökologischer Weinbau nur mit Piwi-Sorten möglich, sind sich die Experten einig. Daraus gekelterte Weine schmecken ungewohnt anders – aber durchaus interessant.
Die Nachfrage nach ökologischem und vor allem «klima-schonend» produziertem Wein steigt stetig an. Dabei wird ökologisch mit biologisch gleichgestellt. Die beiden Begriffe sind jedoch nicht deckungsgleich. «Ökologischer Weinbau ohne pilzwiderstandsfähige Rebsorten, den sogenannten Piwi-Sorten, ist nicht möglich», sagt Valentin Blattner.
 Am Samstag, 9. August 2014 strahlte das Schweizer Radio eine fundierte Sendung mit einem ehrlichen Plädoyer für Piwi-Rebsorten aus. Klicken Sie auf das Logo von Radio SRF 1 um den Beitrag zu hören.
Am Samstag, 9. August 2014 strahlte das Schweizer Radio eine fundierte Sendung mit einem ehrlichen Plädoyer für Piwi-Rebsorten aus. Klicken Sie auf das Logo von Radio SRF 1 um den Beitrag zu hören.
Seit bald 30 Jahren züchtet und verbessert Valentin Blattner in Soyhières/JU solche Reben. Cabernet Jura hat bereits einen Namen. Zahlreiche weitere Standardsorten sind international erhältlich, tragen aber neben Valentin Blattners Kürzel VB erst Zuchtnummern wie 32-7 oder 26-18. Claude Chiquet, der bei Valentin Blattner arbeitete, machte sich seinen Wissensvorsprung zu Nutze und wählte für die Rebberge in Ormalingen und Maisprach, beide im Kanton Basel Landschaft gelegen die besten Sorten aus. VB CAL 1-36, VB CAL 1-15 und VB CAL 1-22 verarbeitet er zu einem roten Schaumwein. «Sekt bei Kellertemperatur lagern. Vor dem Servieren 90 Minuten in den Tiefkühler legen», steht auf der Rückenetikette des Schwarze Perle Crèmant Brut. «Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung», mahnt Claude Chiquet, Winzer und Produzent des Weines. «Öffnen Sie die Flasche vorsichtig und halten Sie Gläser bereit, sonst endet der Weinservice in einer Katastrophe.» Ein gutes Stichwort. Denn eine Katastrophe stand am Anfang der Entwicklung von zahlreichen neuen Rebsorten, die heute mehr denn je ins Zentrum des Interesses rücken. Was war geschehen?
Die grösste Weinkrise aller Zeiten
Als Ergebnis der Freihandelspolitik unter Kaiser Napoleon III. erlebte der französische Wein noch nie dagewesene Exporterfolge. Als plötzlich ganze Schiffsladungen Wein als ungeniessbar zurückgeschickt wurden, stand der gute Name Frankreichs auf dem Spiel und eine bedeutende Branche vor dem Abgrund. Der Grund dafür, so stellte sich heraus, waren eingeschleppte Schädlinge und Krankheiten.
Europäische Auswanderer, die den Amerikanischen Kontinent besiedelten, fanden dort nebst viel Unbekanntem auch Reben. Daraus gekelterter Wein schmeckte aber anders als derjenige, den sie aus ihrer Heimat mitbrachten, nämlich ungewohnt wild, sauer und walderdbeerfruchtig. So holten sich die Siedler Reben in Europa, pflanzten diese in Amerika und mussten beobachten wie die Chardonnay-, Sauvignon-Blanc-, Cabernet- oder Pinot-Noir-Reben starben bevor sie einen ersten Ertrag lieferten. Interessierte Botaniker wollten wissen, ob umgekehrt amerikanische Reben in Europa überleben würden. Ohne Vorahnung der Folgen, schleppten sie als blinde Passagiere den Echten Mehltau (1847), die Reblaus (um 1860) sowie den Falschen Mehltau (1878) nach Europa ein. Mit deren Ausbreitung wurden verschiedene Weinbauregionen Europas wirtschaftlich ruiniert und entvölkerten sich. Allein in Frankreich wurden 30 Prozent der Rebfläche aufgegeben. Im Kanton Zürich, dem damals grössten Weinbaukanton, schrumpfte die Rebfläche von einst über 5.000 Hektar auf heute knapp 614 Hektar. Während das Aufpfropfen von europäischen Edelreben auf amerikanische Wurzeln die Reblaus ausschaltet, müssen die Reben als Schutz vor den beiden Mehltaupilzen seither mehr oder weniger häufig mit Spritzmitteln behandelt werden.
Auf der Suche nach neuen Rebsorten
Sehr bald wurde bemerkt, dass Amerikanerreben dem Mehltau widerstehen und sich ohne Pflanzenschutz kultivieren lassen. Wegen des eigentümlichen Weingeschmacks, der als Foxton oder «Chatzeseicherli» bezeichnet wird, bleibt deren Ausdehnung vorerst bescheiden. Französische Rebzüchter wie Seibel oder Seyve-Villard beginnen mit der Kreuzung von europäischen Rebsorten mit amerikanischen. Da die Rebe selbstbestäubend ist, muss dieser natürliche Vorgang bei der Kreuzung verhindert werden. Kurz bevor sich die Blütchen öffnen, entfernt man dazu mit einer Pinzette deren Blütenkäppchen und die darin vorhandenen Staubbeutel und befruchtet die Stempel mit dem Blütenstaub der anderen Sorte. Dann lässt man die Traube wachsen und reifen. Bei der Ernte interessieren vor allem die Kerne.
Ausgesäht wachsen daraus junge Reblein. Geschwister wie bei den Menshen und alle mit einem anderen Charakter. So entstand aus dem Sämling 88 der Kreuzung Riesling x Silvaner die Scheurebe, die auch S 88 oder Sämling genannt wird. Aus einer Kreuzung der Sorten Gamay x Reichensteiner entstanden die in der Schweiz bekannten Sorten Gamaret und Garanoir. Was sich einfach anhört ist in der Tat hoch komplex. Die weisse Sorte Seyval Blanc zum Beispiel ist das Ergebnis von 25 Kreuzungen aus 28 Rebsorten über sieben Generationen. Der Züchtungsbetrieb Seyve-Villard verwendete dazu mehret Seibel-Reben. Im Jahr 1925 umfasste der Katalog von Seibel 1086 neue Rebsorten. Immer wenn sich der Mehltau besonders stark ausbreitete, erlebten die Hybridreben, auch interspezifische Sorten genannt, einen Aufschwung. 1955 wurden sie, abgesehen von einigen Ausnahmen, verboten. 1979 mussten auch die ursprünglich tolerierten Rebsorten gerodet werden. Von den Hybridreben, sind heute nur noch im Departement Ardèche einige wenige Hektaren übrig geblieben und der Wein geniesst den Schutz eines alten Kulturgutes.

 In der Schweizerischen Zeitschrift für Obst- und Weinbau SZOW waren Piwi-Rebsorten und Piwi-Weine im Jahr 2006 gleich zweimal ein Thema. In der Ausgabe 16 berichtete Valentin Blattner über seine neuen Rebsorten. In der Ausgabe 20 srieben Theo Temperli und Daniel Pulver von der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW und Hans Peter Ruffner von der SZOW über die Ergebnisse der Sortenprüfung einiger dieser Piwi-Sorten. Beide Artikel können per Mauskllick auf die entsprechenden Bilder heruntergeladen werden.
In der Schweizerischen Zeitschrift für Obst- und Weinbau SZOW waren Piwi-Rebsorten und Piwi-Weine im Jahr 2006 gleich zweimal ein Thema. In der Ausgabe 16 berichtete Valentin Blattner über seine neuen Rebsorten. In der Ausgabe 20 srieben Theo Temperli und Daniel Pulver von der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW und Hans Peter Ruffner von der SZOW über die Ergebnisse der Sortenprüfung einiger dieser Piwi-Sorten. Beide Artikel können per Mauskllick auf die entsprechenden Bilder heruntergeladen werden.
Obwohl es ruhig wurde um die Hybriden, ging die Züchtung von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten in Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn und seit Anfang der 1980er-Jahre auch auf privater Basis in der Schweiz, weiter. Wie bereits beschrieben sind die Verfahren extrem aufwändig. «Es ist nicht möglich durch einfaches Kreuzen der Eltern A und B die ‹Sorte des Bedürfnisses› zu züchten», schreibt Valentin Blattner in einem Artikel in der Schweizerischen Zeitung für Obst- und Weinbau. «Durch Kombinationen genetischer Eigenschaften werden Frosthärte, Austriebszeitpunkt, aufrechter Wuchs, Reifezeitpunkt, tolerantes Verhalten bei Reifeüberschreitung, Weinaromatik und ein komplexes Pilzwiderstandspotenzial beeinflusst.» Eine Krankheitsresistenz, die auf einer einzigen Abwehrstrategie beruhe, sei erfahrungsgemäss zum Scheitern verurteilt und würde nicht lange halten. Die neuen Valentin-Blattner-Sorten (VB-Sorten) beinhalten Kombinationen verschiedener Abwehrreaktionen mit dem Ziel, dass pilzliche Krankheitserreger eine Resistenz nicht so schnell durchbrechen können. Berücksichtigt man alle grundlegend wichtigen Anforderungen, so ist es logisch, dass viele Kreuzungsschritte notwendig sind, um eine Kombination der gewünschten Merkmale zu erhalten.» Zur Zeit arbeiten Valentin Blattner und der katalanische Bio-Winzer Josep Maria Albet i Noya an einem Projekt, bei dem Resistenzen in eine traditionelle Rebsorte eingekreuzt werden sollen ohne deren Geschmacksprofil zu verändern. Erste brauchbare Ergebnisse werden in 15 Jahren erwartet.
Überraschende Aromastrukturen
Neben Blattners «26er-Kreuzungen» sind vor allem seine «CAL-Sorten» vielversprechend. Sie entsprechen den modernen Anforderungen bezüglich Wuchsverhalten, trotzen dem Echten Mehltau und weisen eine interessante Aromatik auf. Verkoster vom Weinmagazin Vinum haben im April 2013 Piwi-Weine unter die Lupe genommen. Von 273 verkosteten Mustern erreichten neun Weine 16 von 20 möglichen Punkten. Sechs davon waren Schweizer, drei stammten aus Deutschland. 60 Weine waren von überdurchschnittlicher Qualität, weitere 37 gut und 167 nicht erwähnenswert.
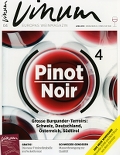 In der Aprilausgabe 2013 hat Vinum, Europas Weinmagazin, Piwi-Weine verkostet und ist zum geschilderten Ergebnis gekommen. Wie den Redaktoren die «besten» 88 Weine geschmeckt haben, können Sie nachlesen, wenn Sie auf's Bild klicken.
In der Aprilausgabe 2013 hat Vinum, Europas Weinmagazin, Piwi-Weine verkostet und ist zum geschilderten Ergebnis gekommen. Wie den Redaktoren die «besten» 88 Weine geschmeckt haben, können Sie nachlesen, wenn Sie auf's Bild klicken.
Eine andere Erfahrung machte der Autor dieses Artikels. Als Vorbereitung verkostete er 44 Piwi-Weine. Alle Weine waren sehr sauber gekeltert, hatten Charme, waren lebendig, vielschichtig, von eigener Persönlichkeit und in angebrocherner Flasche ohne Qualitätsverlust mehr als zehn Tage haltbar. Neben den vier abgebildeten, hatte jeder Wein eine Besonderheit. So ist der Vidal Blanc von Zweifel eine easy-drinking «Einstiegsdroge» für junge Leute (mit Moderation zu konsumieren). Die feine Muskatnote, etwas Restsüsse sowie 10 Volumenprozente Alkohol machen ihn in der Gastronomie zum idealen Begleiter von Fruchtdesserts, Gebäck oder Käse. Ein ganz anderes Kaliber ist der Vidal Blanc vom Weingut Strasser-Torriani aus Benken. Vielschichtig und monumental verlangt er nach kräftigen Speisen. Die Weissen Piwi-Weine haben es faustdick hinter den Ohren. Auch die Roten müssen sich nicht verstecken. Klar haben sie nicht die Dichte eines grossen Burgunders oder die Kraft eines Crus aus dem Bordelais. Doch ihre Frische wird nie langweilig. So lässt man sich vom Blue Velvet von der Bielersee-Kellerei Räblus, den Cabernet Jura von Lenz am Thurgauer Iselisberg oder den Gewächsen vom Frohhof in Neftenbach/ZH gerne verführen. Einzig der Maréchal Foch von Pirmin Umbicht passte nicht ins Bild. Aber das hatte der Produzent im Weinbeschireb bereits angekündigt. Für seine Ehrlichkeit erhält er 100 Punkte.
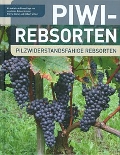 «Die Neuauflage dieses Buches, innerhalb von nur acht Jahren, zeigt die grosse Dynamik in der Entwicklung der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Laufend neue Züchtungen wollen nach ihrer Resitenz und ihrem Potenzial beurteilt werden, so dass der Praktiker die Richtung erahnen kann, welche Weincharakteren und Weintypen sich da auftun können», schreibt Bruno Bosshart, PIWI International Vorstandsmitglied Schweiz, im Vorwort der Neuauflage.
«Die Neuauflage dieses Buches, innerhalb von nur acht Jahren, zeigt die grosse Dynamik in der Entwicklung der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Laufend neue Züchtungen wollen nach ihrer Resitenz und ihrem Potenzial beurteilt werden, so dass der Praktiker die Richtung erahnen kann, welche Weincharakteren und Weintypen sich da auftun können», schreibt Bruno Bosshart, PIWI International Vorstandsmitglied Schweiz, im Vorwort der Neuauflage.
Dieses dichte Netz von Informationen: Erste Anbaueigenschaften, Erfahrungsaustausch von Züchtern, Forschern und Weinbauern hat sich Pierre Basler hartnäckig in der Sache und sehr feinfülig im Umgang mit den beteiligten Akteuren erarbeitet. In der Neuauflage hat Robert Scherz die Arbeit fortgeführt und aktualisiert.
«Egal ob Winzer oder Forscher, höhere Schulen oder Behörden, der Weg geht an pilzwiderstandsfähigen Sortenfragen kaum mehr vorbei», schreibt Bosshart weiter.
Zusätzliche Informationen gibt es mit einem Klick auf das Bild.
(Text: Gabriel Tinguely, Bilder: zVg)
Zurück
Das ist PIWI
PIWI ist der Gattungsname für pilzwiderstandsfähige Traubensorten. Piwi-Traubensorten entstehen aus Neuzüchtungen.
Das Potenzial für erstklassige Weine ist eine übergeordnete Grundbedingung aller Zuchtaktivitäten. Nicht dass das der Anstoss zum Züchten wäre, guten Wein git es ja schon lange. Der Grund liegt bei den schwierigen, intensivern und unökologischen Pflegemassnahmen, welche die traditionellen Europäersorten benötigen. Das Zuchtziel ist eine grössere Widerstandskraft der Rebpflanze gegen Pilzkrankheiten. Dies äussert sich durch weniger Spritzen und – falls doch notwendig – im Einsatz von harmloseren Mitteln.
PIWI im Weinglas:
- Faszinierende Erweiterung des Heinhorizonts
- Erstaunliches Erlebnis für Nase und Gaumen
- Überraschende Aromastrukturen
- Beeindruckende Intensität
Naturnaher Rebbau = PIWIs + Biodiversität, so definert Claude Chiquet, Winzer in Oramlingen seine Arbeit.
Die Anwesenheit einer grossen Vielfalt von Insekten begrenzt auf natürliche Weise ein Überhandnehmen von Schädlingen. Voraussetzung dafür ist eine reiche Struktur- und Pflanzenvielfalt zwischen den Rebstöcken. Das wiederum bedingt eine angepasste Bodenbewirtschaftung. Es werden gezielt Blütenpflanzen und tiefwurzelnde Leguminosen eingesät, zur Stickstoffversorgung der Reben und als Futterquellen für Insekten.
Die strengsten Bio-Richtlinien Europas
Die Biodiversität in den Rebbergen ist seit über 30 Jahren ein Anliegen von Delinat. So gehen die Delinat-Richtlinien heute weit über generelle Anforderungen an den Biolandbau sowie andere Biorichtlinien (EU, Bio Suisse, Demeter) hinaus. In einer Tabelle auf der Website können die wichtigsten Unterschiede eingesehen werden.
Piwi-Weine in der Schweiz
Eine unvollständige Liste der Piwi-Rebsorten, Winzer und Weine aus Schweizer Produktion (Stand 26.08.2014).
sr bedeutet sortenrein,
ass steht für Assemblagen.
| Weisse Rebsorten |
Wein- |
Winzer- adressen |
| Bianca | 2 / 0 | 12 |
| Bronner | 0 / 1 |
2 |
| GF 48-12 | 0 / 0 |
7 |
| Johanniter | 1 / 3 | 29 |
| Kalina | 0 / 0 |
2 |
| Orion | 0 / 0 |
1 |
| Réselle | 0 / 0 |
1 |
| Saphira | 1 / 0 |
2 |
| Seyval Blanc | 5 / 1 |
25 |
| Solaris | 2 / 2 |
34 |
| Sauvignon Soyhières | 2 / 0 |
1 |
| VB 32-7 «La Blanche» | 1 / 2 |
5 |
| Vidal Blanc | 2 / 2 |
3 |
| Blaue Rebsorten |
Wein- |
Winzer- adressen |
| Baco Noir |
0 / 0 |
1 |
| Baron | 0 / 0 |
1 |
| Cabernet Carbon |
0 / 0 |
2 |
| Cabernet Carol |
0 / 0 |
1 |
| Cabernet Cortis |
0 / 0 |
5 |
| Cabernet Jura |
3 / 8 |
29 |
| Cabernet PIWI |
1 / 1 |
1 |
| Cabertin (VB 91-26-17) |
0 / 0 |
1 |
| Chambourcin | 2 / 4 |
5 |
| Katawaba | 0 / 0 |
1 |
| Léon Millot |
1 / 6 |
28 |
| Maréchal Foch |
5 / 8 |
40 |
| Millot x Foch |
0 / 0 |
1 |
| Monarch | 0 / 0 |
1 |
| Muscat Bleu |
0 / 2 |
14 |
| Prior | 0 / 0 |
1 |
| RAC 3209 |
0 / 1 |
1 |
| Regent | 1 / 6 |
94 |
| Roesler | 0 / 1 |
1 |
| Rondo | 1 / 0 |
5 |
| Seibel 5455 / Plantet |
0 / 0 |
1 |
| Seibel 7053 / Chancellor |
0 / 0 |
2 |
| Siramé / Salomé |
0 / 0 |
3 |
| VB 91-26-01 |
0 / 0 |
1 |
| VB 91-26-04 |
0 / 1 |
2 |
| VB 91-26-25 |
0 / 0 |
1 |
| VB CAL 1-15 |
0 / 1 |
1 |
| VB CAL 1-22 |
0 / 0 |
1 |
| VB CAL 1-28 |
0 / 3 |
1 |
| VB CAL 1-26 |
0 / 2 |
1 |



